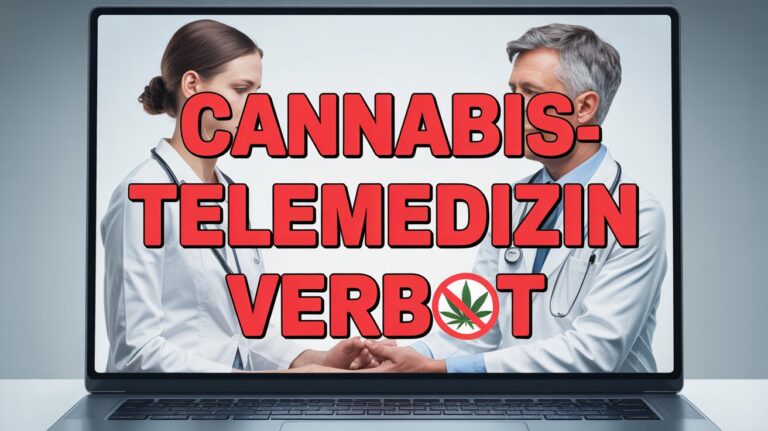Zum 1. April 2024 ist in Deutschland das Cannabisgesetz (CanG) in Kraft getreten und hat damit einen grundlegenden Wandel in der Cannabispolitik eingeläutet. Erstmals seit Jahrzehnten dürfen Volljährige unter bestimmten Auflagen Cannabis besitzen und anbauen, ohne sich strafbar zu machen. Dieses „Cannabis-Legalisierung light“ Modell soll den Schwarzmarkt eindämmen, den Jugendschutz stärken und den Konsum in geregelte Bahnen lenken. Dennoch gelten weiterhin klare Grenzen und Verbote, um Missbrauch und Risiken zu minimieren. Im folgenden Ratgeber beleuchten wir ausführlich alle wichtigen Regelungen – von erlaubten Besitzgrenzen über Konsumorte bis hin zu Privatanbau und den neuen Cannabis-Clubs (Anbauvereinigungen). Außerdem erklären wir die Unterschiede zum medizinischen Cannabis, die Konsequenzen im Straßenverkehr sowie etwaige Unterschiede in den Bundesländern. Jedes Kapitel bietet fundierte Informationen in verständlicher Sprache – für Konsumenten, interessierte Bürger und potenzielle Vereinsgründer gleichermaßen.
Besitzgrenzen für Erwachsene
Seit Inkrafttreten des Cannabisgesetzes dürfen Erwachsene in Deutschland eine begrenzte Menge Cannabis zum Eigenkonsum straffrei besitzen. Konkret liegt die Besitzgrenze bei 25 Gramm Cannabis pro Person, die man außerhalb der eigenen Wohnung bei sich haben darf. Zu Hause – im eigenen Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthaltsort – sind sogar bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis erlaubt. Diese höheren Mengen im privaten Bereich sollen es ermöglichen, Ernteerträge aus Eigenanbau oder Vereinsbezug zu lagern, ohne direkt gegen das Gesetz zu verstoßen. Wichtig: Die erlaubten Mengen gelten pro volljähriger Person. Leben also beispielsweise zwei Erwachsene in einem Haushalt, darf jeder für sich bis zu 50 g daheim besitzen.
Diese offizielle Infografik veranschaulicht die neuen Besitzregeln: Volljährige dürfen bis zu 25 g Cannabis außerhalb der Wohnung mitführen und bis zu 50 g in den eigenen vier Wänden lagern. Zudem ist der Anbau von bis zu 3 Pflanzen pro Person erlaubt (siehe unten). Mengen darüber hinaus sind weiterhin verboten und können sanktioniert werden. Grundsätzlich gilt: Cannabis bleibt für Minderjährige komplett illegal – Ausnahmen gelten nur für Personen ab 18 Jahren.
Wird die erlaubte Menge geringfügig überschritten, droht anstelle eines Strafverfahrens ein Bußgeldverfahren. Das Gesetz stuft den Besitz von über 25 g bis 30 g (unterwegs) bzw. über 50 g bis 60 g (zu Hause) als Ordnungswidrigkeit ein. In solchen Fällen kann eine Geldbuße verhängt und das Cannabis eingezogen werden. Bei deutlicheren Überschreitungen – mehr als 30 g in der Öffentlichkeit oder insgesamt über 60 g – macht man sich jedoch wieder strafbar. Der Besitz solcher Mengen gilt als erheblich („nicht geringe Menge“) und kann gemäß dem neuen Recht mit Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren geahndet werden. Ähnliches gilt beim Anbau von mehr als 3 Pflanzen (Details dazu im Abschnitt Privater Anbau). Es ist daher dringend angeraten, die vorgegebenen Grenzen einzuhalten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Unverändert strikt bleibt das Verbot für Jugendliche: Unter 18 Jahren ist der Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis weiterhin verboten. Wird ein Minderjähriger mit Cannabis angetroffen, kann dies polizeiliche Maßnahmen und Meldung an das Jugendamt nach sich ziehen. Für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren gelten zwar dieselben Besitzgrenzen wie für Ältere, jedoch gibt es Einschränkungen bei der Abgabe in Cannabis-Clubs (siehe Anbauvereinigungen): Dort dürfen sog. Heranwachsende nur Cannabis mit reduziertem THC-Gehalt erhalten. Ansonsten differenziert das Gesetz bei den Besitzmengen nicht nach Altersgruppen – jeder Volljährige hat dieselben Gramm-Grenzen. Insgesamt markieren 25 g (öffentlich) bzw. 50 g (privat) die zentrale Schwelle zwischen erlaubtem Eigenbedarf und ordnungswidrigem Überschuss.
Konsumorte und Konsumverbote
Obwohl Cannabis für Erwachsene nun legal in geringen Mengen besessen werden darf, ist der öffentliche Konsum nur eingeschränkt gestattet. Insbesondere soll verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche Cannabisrauchen mitbekommen oder belästigt werden. Dementsprechend verbietet das Gesetz den Konsum von Cannabis in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen. Konkret darf nicht in der Gegenwart von Personen unter 18 Jahren gekifft werden. Dieses Verbot erstreckt sich auf Orte, an denen sich üblicherweise Kinder und Jugendliche aufhalten:
- Schulen, Kitas und Spielplätze – sowohl auf dem Gelände selbst als auch in deren Sichtweite (ca. 100 m Radius).
- Jugendeinrichtungen (z. B. Jugendzentren) – ebenfalls auf dem Gelände und im Umkreis von 100 m.
- Öffentlich zugängliche Sportstätten (Sportplätze, Stadien etc.) – auf dem Gelände und im 100 m-Umkreis.
- Fußgängerzonen in Innenstädten – allerdings zeitlich begrenzt: hier gilt ein Konsumverbot zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends. Außerhalb dieser Zeiten (nachts) ist der Konsum dort rechtlich erlaubt, sofern keine Jugendlichen in der Nähe sind.
- Öffentlicher Nahverkehr – in Bussen, Bahnen sowie in Bahnhofsgebäuden ist das Cannabisrauchen untersagt, ähnlich wie Rauchen von Tabak.
Diese Aufzählung beschreibt die wichtigsten Tabuzonen. „In Sichtweite“ bedeutet in der Regel weniger als 100 m Abstand zum Eingangsbereich der genannten Einrichtungen. Damit soll sichergestellt werden, dass beispielsweise kein Rauch vom Schulhof aus sichtbar oder riechbar ist. Außerhalb dieser Verbotszonen ist der öffentliche Konsum prinzipiell erlaubt – etwa im Park, am See oder auf der Straße – jedoch immer unter der Voraussetzung, dass keine Kinder in unmittelbarer Nähe sind und keine lokalen Regeln dagegensprechen. Viele Städte oder Gemeinden können z. B. im Rahmen ihrer Hausordnungen für Parks oder Badeseen weitere Einschränkungen festlegen. Es lohnt sich daher, Hinweisschilder an öffentlichen Plätzen zu beachten. Und auch wenn das Gesetz es unter oben genannten Bedingungen erlaubt: gegenseitige Rücksichtnahme (etwa gegenüber Nichtrauchern in der Umgebung) bleibt geboten.
In Innenräumen greift zudem das allgemeine Nichtraucherschutzgesetz der Länder: Wo das Rauchen von Tabak verboten ist (z. B. in Restaurants, Clubs, öffentlichen Gebäuden), darf auch kein Joint geraucht werden. Selbst in ausgewiesenen Raucherräumen können Betreiber per Hausrecht den Konsum von Cannabis untersagen. Anders verhält es sich nur, wenn Cannabis in nicht-rauchender Form konsumiert wird (z. B. als Essware oder verdampft ohne Verbrennung) – dann fällt es nicht unter das Nichtraucherschutzgesetz. Trotzdem steht es jedem Gastronom frei, Cannabis-Konsum generell in seinem Lokal zu verbieten. Arbeitnehmer sollten ebenfalls vorsichtig sein: Während der Arbeitszeit oder in Pausen auf dem Betriebsgelände ist Kiffen in der Regel untersagt, vergleichbar mit Alkohol. Viele Arbeitgeber haben klare Richtlinien, die den Konsum psychoaktiver Substanzen während der Arbeit ausschließen. Wer unsicher ist, sollte vorab mit dem Arbeitgeber sprechen, anstatt in der Mittagspause zum Joint zu greifen. Grundsätzlich gilt: Erlaubt ist der Konsum hauptsächlich im privaten Rahmen (z. B. Zuhause) oder draußen unter Beachtung der genannten Auflagen – nicht jedoch überall und jederzeit.
Einige Bundesländer haben über die Bundesregeln hinaus zusätzliche Konsumverbote erlassen. So untersagt etwa Bayern vorsorglich den Cannabiskonsum auf Volksfesten und in Biergärten komplett. Zudem wurden dort für bestimmte öffentliche Parks (z. B. den Englischen Garten in München) lokale Verbote ausgesprochen. Andere Länder behalten sich ähnliche Schritte vor oder prüfen noch, ob sie stark frequentierte öffentliche Bereiche zu cannabisfreien Zonen erklären. Hier lohnt es sich, die Anordnungen des eigenen Bundeslands oder der Kommune im Blick zu behalten – gerade bei Veranstaltungen oder an beliebten Treffpunkten kann es individuelle Verbote geben. Insgesamt ist die Devise: Cannabis darf zwar legal konsumiert werden, aber nur an geeigneten Orten ohne Gefährdung oder Beeinträchtigung Dritter, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
Private Anbauvorschriften (Eigenanbau)
Ein zentraler Bestandteil der neuen Regulierung ist, dass Erwachsene nun Eigenanbau betreiben dürfen. Jeder Volljährige mit Wohnsitz in Deutschland (seit mindestens 6 Monaten) darf bis zu 3 Cannabispflanzen gleichzeitig privat anbauen. Diese Grenze von drei Pflanzen gilt pro Person – leben also mehrere Erwachsene in einem Haushalt, darf jeder bis zu drei eigene Pflanzen kultivieren. Erlaubt sind ausschließlich weibliche blühende Pflanzen zur Gewinnung von Konsumcannabis; der Anbau von Nutzhanf (Industriehanf) im privaten Rahmen fällt ebenfalls unter diese Beschränkung. Wichtig: Man darf jederzeit maximal drei Pflanzen gleichzeitig wachsen haben – ein Überschreiten (z. B. durch Stecklinge oder zusätzliche Pflanzen) ist illegal und verpflichtet den Hobbygärtner zur sofortigen Vernichtung aller überzähligen Pflanzen. Das bedeutet auch, dass bei einer neuen Pflanzung zuerst geerntet oder abgebaut werden muss, bevor eine weitere Pflanze hochgezogen werden darf, sofern man schon drei Exemplare besitzt. Sobald jedoch 4 oder mehr Pflanzen kultiviert werden, macht man sich strafbar. Ebenso darf der Vorrat aus eigener Ernte 50 g nicht überschreiten, ohne gegen die Besitzgrenze zu verstoßen. Private Züchter müssen ferner beachten, dass selbst erzeugtes Cannabis wirklich nur dem Eigenkonsum dient – eine Weitergabe, auch unentgeltlich an Freunde oder Nachbarn, ist gesetzlich verboten.
Um den Jugendschutz zu gewährleisten, schreibt das Gesetz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen für den Heimanbau vor. Cannabis-Pflanzen sowie das geerntete Marihuana/Haschisch müssen vor dem Zugriff durch Kinder, Jugendliche oder unbefugte Dritte geschützt werden. Praktisch bedeutet das, dass man die Pflanzen an einem sicheren Ort halten sollte – idealerweise in abschließbaren Räumen oder Schränken, zu denen Minderjährige keinen Zugang haben. Auch Erntebestände (getrocknete Blüten etc.) sind entsprechend wegzuschließen. Zusätzlich darf der private Cannabis Anbau keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft verursachen. Gerade Geruch kann hier ein Thema sein: Der intensive Cannabis-Duft während der Blütephase oder beim Trocknen könnte als Störung empfunden werden. Es empfiehlt sich daher, für ausreichende Belüftung oder Luftfilter zu sorgen, um Geruchsbelästigung zu minimieren. Wer diese Vorsichtsmaßnahmen einhält, ist auf der sicheren Seite und zeigt, dass Eigenanbau verantwortungsvoll betrieben wird.
Ein häufiger Praxis-Frage ist, wie man legal an Saatgut oder Setzlinge kommt, um mit dem Eigenanbau zu starten. Der Erwerb von Cannabissamen ist seit 2024 aus legalen Quellen innerhalb der EU ausdrücklich gestattet. Das bedeutet, man darf Samen (auch online) von Anbietern aus EU-Ländern beziehen, ohne gegen das BtMG zu verstoßen. Wichtig ist jedoch, dass die Samen zum Eigenanbau bestimmt sind und nicht unerlaubt weiterverkauft werden. Alternativ können künftig auch Cannabis-Clubs Saatgut oder Jungpflanzen zur Verfügung stellen (siehe nächstes Kapitel) – sogar an Nicht-Mitglieder, allerdings in begrenzter Menge. Laut Gesetz dürfen Vereine an externe Erwachsene bis zu 7 Samen oder 5 Stecklinge pro Monat abgeben. Somit haben Hobbygärtner mehrere legale Möglichkeiten, pflanzliches Ausgangsmaterial zu erhalten. Klar verboten bleibt hingegen der Kauf von Setzlingen oder Pflanzen auf dem Schwarzmarkt. Auch der Import von Samen aus Nicht-EU-Staaten oder das Mitbringen von Samen über die Grenze ist problematisch, da hier Zoll- und Einfuhrbestimmungen greifen. Man sollte sich also auf die vorgesehenen legalen Bezugswege beschränken. Hat man die ersten legale Saatgut ergattert, steht dem grünen Daumen nichts mehr im Wege – natürlich immer im Rahmen der oben genannten Vorschriften.
Anbauvereinigungen (Cannabis-Clubs)
Eine der größten Neuerungen des Cannabisgesetzes ist die Einführung sogenannter Anbauvereinigungen – oft auch als „Cannabis Social Clubs“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um nicht-kommerzielle Vereine oder Genossenschaften, in denen Mitglieder gemeinschaftlich Cannabis anbauen und untereinander verteilen dürfen. Diese Clubs dienen dem Zweck, Erwachsenen einen legalen Zugang zu Cannabis außerhalb des eigenen Anbaus zu ermöglichen, ohne gleich den Schritt zu kommerziellen Verkaufsstellen zu gehen. Seit dem 1. Juli 2024 können solche Anbauvereinigungen offiziell tätig werden – davor mussten erst die rechtlichen und behördlichen Voraussetzungen geschaffen werden.
Cannabis-Club auf einen Blick: Die Infografik fasst die wichtigsten Eckpunkte zusammen. Ein Verein darf max. 500 Mitglieder haben, nur Erwachsene (18+) werden aufgenommen. Jeder darf nur Mitglied in einem einzigen Club sein. Der Anbau beginnt erst nach behördlicher Genehmigung und dient ausschließlich der Bedarfsdeckung der Mitglieder. Weitergabe oder Verkauf an Außenstehende ist strikt untersagt.
Voraussetzungen und Zulassung
Wer einen Cannabis-Club gründen möchte, muss sich an strenge Vorgaben halten. Zunächst muss die Organisation als gemeinnütziger Verein oder Genossenschaft formal gegründet und im Vereinsregister eingetragen sein. Das allein genügt aber nicht – der Club benötigt zwingend eine behördliche Erlaubnis zum Cannabis-Anbau gemäß CanG. Zuständig sind je nach Bundesland unterschiedliche Behörden (z. B. Landesgesundheitsämter oder spezialisierte Stellen); in Niedersachsen erteilt beispielsweise die Landwirtschaftskammer die Anbau-Genehmigungen. Ein Antrag mit umfangreichen Angaben zum Verein, Anbauort, Sicherheitskonzept etc. ist erforderlich. Ohne die offizielle Genehmigung darf kein einziges Pflänzchen gezogen werden – der Startschuss fällt also erst nach positivem Bescheid.
Die Zahl der Mitglieder pro Anbauvereinigung ist auf 500 Personen begrenzt. Alle Mitglieder müssen volljährig sein und – wie beim Eigenanbau – seit mindestens 6 Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Eine Person darf immer nur in einem einzigen Cannabis-Verein Mitglied sein, Mehrfachmitgliedschaften sind ausgeschlossen. Außerdem muss die Satzung eine Mindestmitgliedszeit von 3 Monaten vorsehen, um zu verhindern, dass Leute kurzfristig eintreten nur zum „Hamstern“ von Cannabis. Die Vereinsgründer und Vorstände werden behördlich auf ihre Zuverlässigkeit geprüft. Personen, die wegen relevanter Straftaten (insbesondere Drogendelikte) vorbestraft sind oder gegen die Vorschriften des Cannabisgesetzes verstoßen haben, erhalten keine Genehmigung als verantwortliche Organisatoren. Hier setzt man bewusst hohe Maßstäbe, um kriminelle Strukturen fernzuhalten und einen verantwortungsvollen Clubbetrieb zu gewährleisten.
Pflichten und Auflagen für Cannabis-Clubs
Hat ein Verein die Erlaubnis erhalten, muss er eine Reihe von Pflichten erfüllen. Zunächst sind geeignete Anbauflächen oder -räume zu betreiben, die gesichert sind und unbefugten Zutritt verhindern – ähnlich wie beim privaten Anbau, nur in größerem Maßstab. Die Club-Räumlichkeiten dürfen sich nicht in der Nähe sensibler Orte befinden: Ein Mindestabstand von 200 m zu Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen und Spielplätzen ist vorgeschrieben. Damit soll verhindert werden, dass Jugendliche indirekt mit dem Vereinsanbau in Kontakt kommen. Der Konsum vor Ort im Club ist übrigens nicht vorgesehen – im Gegenteil, im Umkreis von 100 m um das Vereinsgelände gilt ebenfalls ein Konsumverbot, um keine „Hotspots“ zu schaffen.
Ein Club darf Cannabis nur an seine eigenen Mitglieder abgeben, und auch das nur in strikt limitierten Mengen. Pro Mitglied sind maximal 25 Gramm pro Tag zulässig, wobei pro Monat nicht mehr als 50 Gramm ausgegeben werden dürfen. Diese Werte entsprechen den allgemeinen Besitzgrenzen. Jüngere Mitglieder zwischen 18 und 20 Jahren (Heranwachsende) unterliegen jedoch einer Sonderregel: Sie dürfen höchstens 30 Gramm im Monat erhalten und nur Cannabis mit maximal 10% THC-Gehalt. Dadurch soll das Risiko für diese Altersgruppe reduziert werden. Die Vereine müssen den THC-Gehalt ihres abgegebenen Cannabis also im Blick haben und ggf. durch geeignete Sortenwahl sicherstellen, dass die Grenze eingehalten wird. Eine kommerzielle Testpflicht gibt es zwar nicht, doch im Eigeninteresse dürften viele Clubs die Potenz ihrer Ernte analysieren lassen.
Die Abgabe von Cannabis durch den Verein darf kein Verkauf im klassischen Sinne sein – die Clubs arbeiten gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Erlaubt ist nur die Weitergabe gegen Kostenbeteiligung, um etwa den Anbau und Betrieb zu finanzieren (Mitgliedsbeiträge oder Unkostenbeiträge sind üblich). Werbung für Cannabis oder den Club ist strikt untersagt – die Vereine dürfen also keine Reklame machen oder Sponsoring betreiben, um neue Mitglieder anzuwerben. Weiterhin müssen Anbauvereinigungen Buch über Zu- und Abgänge führen und alle gesetzlichen Vorgaben einhalten, da sie behördlich überwacht werden können. Kommt es zu Verstößen, drohen empfindliche Bußgelder oder im schlimmsten Fall der Entzug der Lizenz.
Verteilung, Samen und Setzlinge
Die durch den Club erzeugten Cannabisprodukte werden in der Regel getrocknet und an die Mitglieder in Rationen ausgegeben. Damit niemand über die erlaubten Mengen hinaus versorgt wird, regelt das Gesetz genau, wie viel ein Vereinmitglied maximal pro Monat erhalten darf (siehe oben). Zudem ist dokumentiert, welcher Ertrag an welches Mitglied ging – so ließe sich Missbrauch nachvollziehen. Überschüsse an Cannabis, die nicht verteilt werden, müssen sicher gelagert oder vernichtet werden; sie dürfen keinesfalls verkauft oder an Außenstehende gelangen. Apropos Außenstehende: Anbauvereinigungen dürfen an Nicht-Mitglieder kein genussfertiges Cannabis abgeben – aber es gibt eine Ausnahme für sogenanntes Vermehrungsmaterial. Vereine dürfen interessierten Erwachsenen bis zu 7 Samen oder 5 Stecklinge pro Monat überlassen, damit diese ihren eigenen privaten Anbau beginnen können. Diese Regelung soll den breiten Zugang zu Saatgut erleichtern, ohne dass jeder gleich Mitglied werden muss. Dennoch bleibt die Mitgliedschaft attraktiv, denn nur Mitglieder profitieren von der Cannabis-Abgabe zur direkten Konsumierung.
Schließlich noch ein Wort zur Verbreitung von Mitgliedschaften: Die Landesregierungen können die Anzahl der Anbauvereinigungen regional begrenzen, um eine Überhitzung zu vermeiden. So dürfen die Länder per Verordnung festlegen, dass pro 6.000 Einwohner maximal ein Cannabis-Club zugelassen wird. In dicht besiedelten Gebieten könnten dadurch Obergrenzen entstehen (z. B. 10 Clubs in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern). Bislang haben noch nicht alle Bundesländer von dieser Option Gebrauch gemacht; es ist jedoch anzunehmen, dass konservativer regierte Länder tendenziell restriktivere Grenzen ziehen werden. Unabhängig davon werden die Behörden genau prüfen, wer einen Verein eröffnet. Für potenzielle Gründer heißt das: Ein detailliertes Konzept, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zur strikten Regelbefolgung sind unerlässlich, um eine Erlaubnis zu erhalten und erfolgreich einen Cannabis-Club zu betreiben.
Regelungen für medizinisches Cannabis
Bereits seit 2017 ist medizinisches Cannabis in Deutschland legal verfügbar, allerdings nur auf Rezept für Patienten mit bestimmten schweren Erkrankungen. Diese bestehende Regelung bleibt auch nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes bestehen und ist von den Neuerungen zum Freizeitgebrauch getrennt. Medizinisches Cannabis (z. B. getrocknete Blüten oder Extrakte in pharmazeutischer Qualität) wird weiterhin über Apotheken an Patienten mit ärztlicher Verordnung abgegeben. Der entscheidende Unterschied: Hier handelt es sich um Arzneimittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und strengen Kontrollen unterliegen. Das neue Cannabisgesetz 2024 hat zwar Cannabis in geringen Mengen für den Freizeitkonsum aus dem Strafrecht herausgenommen, jedoch das medizinische Cannabis parallel in einem eigenen Gesetz – dem Medizinal-Cannabisgesetz – geregelt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Patienten nahtlos weiter ihre Medizin erhalten können, ohne in Konflikt mit den neuen Bestimmungen zu geraten.
Für Patienten ändert sich vorerst wenig: Wer ein Rezept hat, darf nach wie vor seine verordnete Menge aus der Apotheke beziehen und nutzen. Die Mengen können dabei durchaus oberhalb der 25 g/50 g-Grenzen liegen, je nach Therapiebedarf. Besitz von medizinischem Cannabis in der vom Arzt verschriebenen Menge ist legal – Patienten sollten jedoch im Zweifel den Nachweis (z. B. eine Kopie des Rezeptes oder ein Schreiben des Arztes) mit sich führen, um Missverständnisse zu vermeiden. Generell sind Patienten mit Cannabis-Rezept vom Eigenanbau und den Cannabis-Clubs nicht unmittelbar betroffen, da sie ihren Bedarf über das Gesundheitssystem decken. Nichts desto trotz können sich einige praktische Fragen ergeben: Dürfen Patienten nun z. B. selbst anbauen, statt in die Apotheke zu gehen? Hier ist Vorsicht geboten – auch wenn der Eigenanbau für jedermann erlaubt ist, riskieren Patienten unter Umständen Probleme mit der Krankenkasse oder dem Arzt, wenn sie die verordnete Therapie eigenmächtig ersetzen. In der Regel ist es empfehlenswert, die Therapieabsprache mit dem Arzt einzuhalten.
Qualitativ gibt es Unterschiede zwischen medizinischem Cannabis und Freizeitcannabis. Medizinische Produkte unterliegen strengen pharmazeutischen Standards, werden auf genaue THC/CBD-Gehalte und Verunreinigungen geprüft und sind meist in standardisierter Form erhältlich. Das Cannabis aus Eigenanbau oder Anbauvereinigungen kann dagegen in der Potenz variieren und ist nicht zertifiziert – es dient nur dem Freizeitkonsum und genießt kein Arzneimittelprivileg. Verbraucher, die Cannabis primär zu Genusszwecken verwenden, sollten also nicht erwarten, dass „selbst angebaut gleich gut wie aus der Apotheke“ ist, insbesondere was gleichbleibende Wirkstoffgehalte betrifft. Umgekehrt dürfen Patienten ihr medizinisches Cannabis natürlich nicht einfach an Dritte weitergeben; das wäre weiterhin strafbar, da es einem Arzneimittelmissbrauch gleichkäme.
Interessant ist die Frage der Kosten: Medizinisches Cannabis kann in vielen Fällen von der Krankenkasse übernommen werden, wenn eine anerkannte Indikation vorliegt und andere Therapien ausgeschöpft sind. Freizeitkonsum hingegen ist selbstverständlich eine private Angelegenheit und nicht erstattungsfähig. Durch die Legalisierung könnte sich allerdings längerfristig das Preisgefüge ändern – beispielsweise könnten mehr Menschen den Weg über Eigenanbau oder Clubs suchen, anstatt auf dem Schwarzmarkt oder mit hohem finanziellem Aufwand über Apothekenblüten zu gehen (letzteres kommt vor, wenn Patienten kein Kassenrezept bekommen und selbst zahlen müssen). Hier bleibt abzuwarten, wie sich die beiden Parallel-Märkte entwickeln. Klar getrennt sind sie jedenfalls rechtlich: Das eine ist Medizin unter Aufsicht von Ärzten, das andere Genussmittel in Eigenverantwortung.
Abschließend sei erwähnt, dass für medizinisches Cannabis weiterhin die strengen Regeln im Straßenverkehr gelten. Wer Cannabis vom Arzt verschrieben bekommt, darf dennoch kein Fahrzeug führen, wenn er/sie dadurch beeinträchtigt ist. Es gibt zwar Konstellationen, in denen Patienten unter stabiler Therapie als fahrtüchtig gelten können, doch das bewegt sich in einem Graubereich und erfordert meist ein medizinisch-psychologisches Gutachten, um die Fahreignung zu bestätigen. Generell sollten Patienten im Zweifel das Thema mit ihrem Arzt und der Führerscheinstelle klären. Die Legalisierung für Freizeit hat also nicht automatisch Erleichterungen für Patienten in Bezug auf das Fahren gebracht – hier ist nach wie vor Vorsicht und individuelle Prüfung gefragt.
Verkehrsrechtliche Folgen (THC-Grenzwerte & Führerschein)
Eines der heftig diskutierten Themen im Zuge der Cannabis-Legalisierung war der Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Bereits vorher galt: Wer berauschende Mittel konsumiert und ein Fahrzeug führt, macht sich strafbar bzw. begeht eine Ordnungswidrigkeit (abhängig vom Stoff und der Menge). Bei Cannabis war die Rechtslage lange besonders streng, da schon ab 1,0 ng/ml THC im Blutserum praktisch die Fahreignung infrage gestellt wurde. Dieser niedrige Wert entsprach einem faktischen Null-Toleranz-Ansatz und führte dazu, dass selbst gelegentliche Konsumenten Tage nach dem Konsum noch Probleme mit dem Führerschein bekommen konnten. Im Zuge des Cannabisgesetzes 2024 wurde jedoch beschlossen, einen wissenschaftlich fundierteren Grenzwert einzuführen. Eine Expertenkommission empfahl, die Grenze anzuheben, sodass wirklich nur akut beeinträchtigte Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden.
Infolgedessen hat der Gesetzgeber den zulässigen Blut-THC-Grenzwert auf 3,5 ng/ml (Nanogramm pro Milliliter) THC im Blutserum angehoben. Dieser Wert soll etwa dem Risiko entsprechen, das von 0,2 Promille Alkohol ausgeht. Cannabis-Konsumenten haben damit etwas mehr Puffer, bevor sie als fahruntüchtig gelten – der bisherige strenge Grenzwert wurde gelockert. Wichtig zu verstehen: 3,5 ng/ml bezieht sich auf aktives THC im Blutserum, nicht auf Abbauprodukte. Dennoch muss man vorsichtig bleiben, denn 3,5 ng sind immer noch eine geringe Menge, die je nach Konsumverhalten einige Stunden bis teils mehr als einen Tag nach dem Konsum überschritten sein kann. Insbesondere regelmäßige Konsumenten oder Nutzer hochprozentiger THC-Produkte sollten großzügige Pausen zwischen Konsum und Fahrtantritt einplanen. Die Faustregel sollte lauten: Kein Fahren, solange man sich berauscht fühlt – und lieber länger warten, um sicher unter dem Grenzwert zu bleiben.
Die neue Regelung wird im Straßenverkehrsgesetz (StVG) verankert. Praktisch bedeutet es: Wird man bei einer Verkehrskontrolle positiv auf THC getestet, zieht die Polizei in der Regel eine Blutprobe. Liegt das Ergebnis über 3,5 ng/ml, droht ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach StVG §24a (ähnlich wie beim Alkoholverstoß). Das hat in der Regel ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und Fahrverbot zur Folge. Bei deutlich höheren Werten oder im Wiederholungsfall kann auch der Führerschein entzogen werden. Unterhalb von 3,5 ng/ml gilt man nun offiziell nicht als berauscht im straßenverkehrsrechtlichen Sinne. Allerdings muss man immer noch fahrtüchtig sein – sollte also z. B. jemand mit 2 ng/ml im Blut auffällig unsicher fahren, könnte trotzdem eine Fahruntüchtigkeit angenommen werden. Der Grenzwert ist also kein Freifahrtschein, sondern eher eine Entlastung für moderate Konsumenten, die verantwortungsvoll handeln. Die Devise bleibt: Niemals direkt nach dem Kiffen hinters Steuer!
Beachten sollte man zudem, dass unabhängig vom Bußgeldverfahren auch führerscheinrechtliche Maßnahmen drohen, wenn gelegentlicher oder regelmäßiger Konsum festgestellt wird. Die Fahrerlaubnisbehörden prüfen bei bekannt gewordenem Cannabiskonsum die Eignung zum Führen von Fahrzeugen. Bislang galt oft die Regel, dass schon einmaliger oder seltener Konsum in Kombination mit Fahren zu einem medizinisch-psychologischen Gutachten (MPU) führen konnte. Mit der Legalisierung wird erwartet, dass die Behörden hier etwas differenzierter vorgehen – schließlich ist Cannabis nun ein legales Genussmittel. Dennoch wird von einem Fahrer erwartet, strikt zwischen Konsum und Fahren zu trennen. Wer regelmäßig Cannabis konsumiert (selbst legal), muss zeigen, dass er trotzdem jederzeit nüchtern fährt. Im Zweifel kann die Behörde eine MPU anordnen, um die Trennfähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein des Betroffenen zu überprüfen. Es empfiehlt sich daher, auch als legaler Konsument sehr genau aufzupassen: Am Steuer hat Cannabis genauso wenig zu suchen wie Alkohol. Wer beide Substanzen durcheinander konsumiert (Mischkonsum), muss übrigens mit besonders harten Strafen rechnen, falls er erwischt wird.
Unterm Strich bringt die Neuregelung im Verkehrsrecht eine moderate Entkriminalisierung für vernünftige Konsumenten. Gelegenheitskiffer, die mal am Wochenende konsumieren und am nächsten Tag wieder Auto fahren, haben weniger Angst vor dem Führerscheinentzug, solange sie ausreichend Zeit dazwischen lassen. Dennoch bleibt Cannabis am Steuer ein heikles Thema. Die Rechtsprechung und Praxis wird sich hier in den kommenden Jahren noch einpendeln müssen, auch was den Umgang mit registrierten Freizeitkonsumenten angeht. Bis dahin gilt: lieber einmal mehr das Taxi oder die Bahn nehmen, als mit Rest-THC im Blut erwischt zu werden – nicht nur wegen der rechtlichen Folgen, sondern auch aus Verantwortung für die eigene und die Sicherheit anderer.
Unterschiede in den Bundesländern
Obwohl das Cannabisgesetz bundesweit gilt und die wichtigsten Regeln einheitlich vorgibt, gibt es in der praktischen Umsetzung teils Unterschiede zwischen den Bundesländern. Dies betrifft vor allem die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und einige Ausführungsvorschriften. So hat Bayern als erstes Land einen eigenen Bußgeldkatalog für Cannabisverstöße erlassen. Dieser sieht beispielsweise ein Bußgeld von 1.000 € vor, wenn jemand beim Kiffen in Gegenwart von Kindern erwischt wird – im Wiederholungsfall sogar 2.000 €. Andere Länder wie Hamburg, Hessen oder Sachsen haben angekündigt, ebenfalls Bußgeldleitlinien zu entwickeln, variieren aber in der Höhe der angedachten Strafen. Das führt dazu, dass je nach Bundesland unterschiedlich hart durchgegriffen wird: Während man in einem Bundesland für einen Verstoß vielleicht mit einer Verwarnung oder geringem Bußgeld davonkommt, kann es in einem anderen deutlich teurer werden. Dieser „Bußgeld-Flickenteppich“ ist kritisch diskutiert worden, lässt sich aber kaum vermeiden, da die Länder Vollzugs- und Ermessensspielräume haben.
Ein weiterer Punkt sind die bereits erwähnten Konsumverbote im öffentlichen Raum, die Ländersache sein können. Bayern hat hier besonders strikte Regeln erlassen (Verbot auf Volksfesten, in Biergärten und bestimmten Parks). Andere konservativ regierte Länder wie Sachsen oder Baden-Württemberg zeigen ebenfalls eine eher restriktive Haltung und könnten den öffentlichen Konsum im Zweifel stärker beschränken. Liberalere Länder (z. B. Berlin, Bremen) setzen hingegen vorrangig auf die Einhaltung der Bundesvorgaben und auf Aufklärung statt zusätzlicher Verbote. So war Berlin bereits vor der Legalisierung relativ tolerant bei geringen Mengen und dürfte weiterhin eher pragmatisch vorgehen. Dennoch: Wer im Bundesgebiet unterwegs ist, sollte sich lokal erkundigen, ob es besondere Verbotszonen gibt. Gerade Touristen oder Besucher größerer Veranstaltungen (Oktoberfest & Co.) sind gut beraten, vorher zu prüfen, was vor Ort gilt.
Auch bei den Anbauvereinigungen können sich länderspezifische Unterschiede zeigen. Zum einen dürfen die Länder per Verordnung die Dichte der Clubs regulieren (max. 1 Club pro 6.000 Einwohner) – einige Länder werden diese Obergrenze vielleicht ziehen, um eine „Club-Schwemme“ zu vermeiden. Zum anderen ist die Zuständigkeit für die Genehmigung und Überwachung der Vereine unterschiedlich organisiert: Manche Länder richten zentrale Stellen ein, andere übertragen die Aufgabe an bestehende Behörden wie Gesundheitsämter oder (wie in Niedersachsen) die Landwirtschaftskammer. Diese Unterschiede beeinflussen eventuell die Bearbeitungsdauer von Anträgen oder den Schwerpunkt der Kontrollen. Beispielsweise könnte ein Bundesland strengere Auflagen an den Anbauort stellen als ein anderes, je nach Interpretation des Bundesgesetzes. Insgesamt bleibt jedoch der Kern der Regeln überall gleich – die Unterschiede liegen im Detail und der Umsetzung.
Schließlich sei erwähnt, dass die bisherigen tolerierten Obergrenzen („Geringe Mengen“ nach altem Recht, die von Bundesland zu Bundesland schwankten) mit dem neuen Gesetz obsolet geworden sind. Früher hatte z. B. Berlin 15 g als geringe Menge definiert, Bayern hingegen nur 6 g – das führte zu sehr unterschiedlicher Strafverfolgung. Nun gilt bundeseinheitlich: bis 25 g legal, bis 30 g Ordnungswidrigkeit, darüber Straftat. Insofern hat das Cannabisgesetz hier für Klarheit gesorgt. Doch was die konkrete Ausgestaltung von Prävention, Jugendschutz-Maßnahmen und Kontrolldichte angeht, bleibt Raum für Ländereigenheiten. Bürger sollten sich daher neben dem Bundesrecht auch immer über die Praxis im eigenen Wohnort informieren. In offiziellen Mitteilungen der Landesregierungen oder auf deren Webseiten (z. B. dem Cannabis-Infoportal Niedersachsens) findet man aktuelle Hinweise. Zusammenfassend gilt: Das meiste ist nun überall gleich geregelt, aber der Teufel steckt manchmal im Detail der föderalen Umsetzung.
Häufige Fragen zur Cannabis-Regulierung (FAQ)
Nein, nicht vollständig. Es handelt sich um eine Teil-Legalisierung mit klaren Grenzen. Erwachsene dürfen zwar kleine Mengen besitzen (bis 25 g) und auch privat bis zu 3 Pflanzen anbauen, doch darüber hinaus bleibt Cannabis verboten. Auch der Verkauf in Läden ist (außer in Form von Anbauvereinen) weiterhin untersagt. Zudem gelten strenge Regeln zum Konsumort. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt wurde, ist nach wie vor illegal. Man sollte sich also genau an die vorgegebenen Mengen und Orte halten.
Erlaubt ist der Konsum hauptsächlich im privaten Bereich (z. B. in der eigenen Wohnung oder im eigenen Garten). Im öffentlichen Raum darf man prinzipiell auch einen Joint rauchen, aber nicht überall: Verboten ist es in Nähe von Schulen, Kitas, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen, Sportstätten (jeweils im 100 m Umkreis) und in Fußgängerzonen tagsüber. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen ist es untersagt. Viele Innenräume unterliegen dem Nichtraucherschutz, sodass dort auch kein Cannabis geraucht werden darf (z. B. Restaurants, Clubs, Bahnhofsgebäude). Kurz gesagt: Draußen geht es unter Beachtung der Regeln und solange keine Kinder in der Nähe sind; drinnen nur dort, wo Rauchen erlaubt ist und der Betreiber nichts dagegen hat.
Cannabis-Clubs (Anbauvereinigungen) sind Vereine, in denen Mitglieder gemeinschaftlich Cannabis anbauen dürfen. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Wohnsitz in Deutschland haben, um Mitglied zu werden. Jeder Club darf maximal 500 Mitglieder haben. Die Clubs bauen Cannabis an und geben es an die Mitglieder ab – pro Person höchstens 25 g pro Tag und 50 g pro Monat (für 18-20-Jährige max. 30 g/Monat mit niedrigerem THC-Gehalt). Nicht-Mitglieder bekommen kein fertiges Cannabis, können aber bis zu 7 Samen oder 5 Stecklinge im Monat für den Eigenanbau erhalten. Wichtig: Die Clubs dürfen keinen Profit machen, nur die Unkosten decken. Auch vor Ort im Club darf nicht konsumiert werden, und es gibt strenge Auflagen (Sicherheitskonzept, Abstand zu Schulen etc.). Wer einen Club gründen will, braucht eine behördliche Erlaubnis.
Wenn man mit einer geringfügigen Überschreitung erwischt wird (z. B. 30 g in der Tasche statt 25 g), gilt das als Ordnungswidrigkeit. Die Polizei wird das Cannabis sicherstellen und es droht ein Bußgeld. Wie hoch, hängt vom Bundesland und den Umständen ab – es kann im Bereich von einigen dutzend bis mehreren hundert Euro liegen. Hat man deutlich mehr dabei (z. B. 50 g oder 100 g) oder auch über 60 g zu Hause, macht man sich strafbar. Dann kann ein Strafverfahren wegen illegalen Besitzes eingeleitet werden, im schlimmsten Fall mit Freiheitsstrafe (in der Praxis meist Geldstrafen oder Bewährung, wenn man nicht gerade kiloweise Drogen hortet). Gleiches gilt, wenn man mehr als 3 Pflanzen anbaut – auch das ist strafrechtlich relevant. Es lohnt sich also absolut, die Grenzen einzuhalten.
Stand Mai 2025 ist dies nicht möglich. Das neue Gesetz erlaubt keinen freien Verkauf von Cannabis in Geschäften oder Apotheken für Freizeitzwecke. Der Einkauf ist nur indirekt möglich: Entweder man baut selbst an, oder man tritt einem Cannabis-Club bei und erhält dort seine Menge. Die Bundesregierung plant zwar in einem zweiten Schritt regionale Modellprojekte mit lizenzierten Geschäften, aber diese Pilotprojekte stehen noch aus. Bis dahin bleibt der Verkauf außerhalb der Clubs illegal. Wer Cannabis ohne Club beziehen will, muss auf den Eigenanbau setzen oder begeht beim Kauf auf dem Schwarzmarkt weiterhin eine Straftat. Es ist also wichtig zu wissen: Coffeeshops wie in Holland gibt es in Deutschland (noch) nicht.
Vom Konsum von Cannabis und Autofahren ist dringend abzuraten. Zwar wurde der THC-Grenzwert im Blut etwas angehoben (auf 3,5 ng/ml), doch das heißt nicht, dass Fahren „erlaubt“ ist, solange man darunter bleibt. Jeder Rausch kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Wer unter THC-Einfluss Auto fährt und erwischt wird, muss mit Bußgeld, Fahrverbot und Punkten rechnen, ab gewissen Werten auch mit Strafverfahren. Zudem könnte die Fahrerlaubnisbehörde eine Eignungsprüfung (MPU) verlangen, wenn bekannt wird, dass man regelmäßig Cannabis konsumiert. Die beste Regel ist: Nach dem Kiffen ausreichend lange warten, bis man sicher nüchtern ist – im Zweifel lieber 24 Stunden – bevor man wieder ein Fahrzeug steuert. Im Zweifel besser andere Verkehrsmittel nutzen.
Fazit
Das neue Cannabisgesetz hat die Rechtslage in Deutschland grundlegend geändert und den Umgang mit Cannabis deutlich liberalisiert – jedoch in klar abgesteckten Grenzen. Erwachsene können nun Eigenbedarf sicherstellen, ohne sich strafbar zu machen, sei es durch Besitz kleiner Mengen, eigenen Anbau oder die Mitgliedschaft in einem Cannabis-Club. Dies stellt einen Meilenstein in der Drogenpolitik dar und soll langfristig Gesundheits- und Jugendschutz verbessern sowie den Schwarzmarkt verdrängen. Dennoch bleibt Cannabis kein freies Gut wie Tabak oder Alkohol: Zahlreiche Regeln reglementieren, wo und wie konsumiert werden darf, und der Staat behält einen strengen Rahmen bei.
Für Konsumenten bedeutet dies einerseits mehr Freiheit und Eigenverantwortung, andererseits aber auch die Pflicht, sich an die Auflagen zu halten. Wer die erlaubten Mengen überschreitet oder an falschen Orten kifft, muss weiterhin mit Konsequenzen rechnen – von Bußgeldern bis zum Führerscheinverlust. Auch die Ausgestaltung in den Ländern kann variieren, was Aufmerksamkeit erfordert. Positiv ist, dass ernsthafte Strafverfahren für kleine Cannabisdelikte der Vergangenheit angehören und erwachsene Bürger mündiger in ihrer Konsumentscheidung werden.
Insgesamt zeichnet sich ab, dass Deutschland einen vorsichtigen, kontrollierten Legalisierungsweg eingeschlagen hat. Ob die Ziele – insbesondere der Jugendschutz und die Zurückdrängung illegaler Geschäfte – erreicht werden, wird die Zukunft zeigen und ist Gegenstand laufender Evaluierungen durch die Bundesregierung. Für die Bevölkerung heißt es nun, sich mit den neuen Regeln vertraut zu machen. Dieser Ratgeber bietet dazu eine umfassende Grundlage. Wer informiert ist, kann die neuen Freiheiten genießen, ohne ins Fettnäpfchen zu treten. Das Fazit: Cannabis ist „legal, aber…“ – genießen Sie die neu gewonnene Entkriminalisierung verantwortungsbewusst, dann steht einem entspannteren Umgang nichts im Wege.