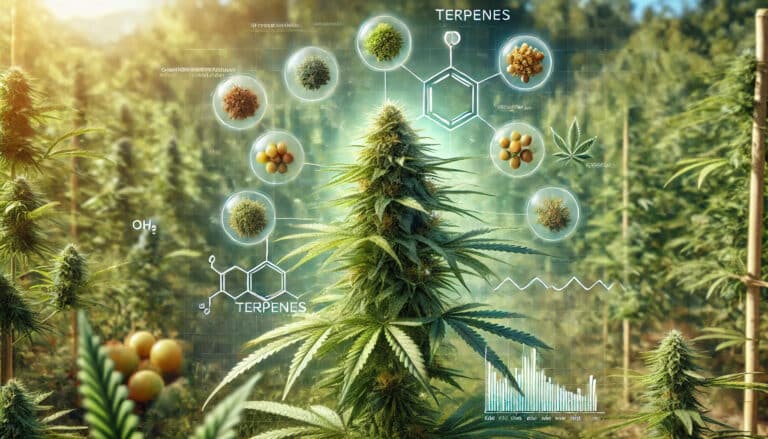Was sind Cannabinoide?
Cannabinoide rücken seit einigen Jahren verstärkt ins öffentliche Interesse – sei es durch die Diskussionen um medizinisches Cannabis, die Entdeckung des Endocannabinoid-Systems oder neue wissenschaftliche Studien zu ihren Wirkungen. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „Cannabinoide“? In diesem Ratgebertext werden die chemischen und biologischen Grundlagen dieser Stoffgruppe erklärt, die verschiedenen Arten von Cannabinoiden vorgestellt, das Endocannabinoid-System (ECS) des Menschen im Detail beleuchtet und die medizinischen Wirkungen sowie aktuelle Forschungsstände zusammengefasst. Der folgende Überblick soll verständlich machen, was Cannabinoide genau sind, wie sie im Körper wirken und bei welchen Beschwerden sie möglicherweise helfen können – basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien.
Was sind Cannabinoide? Chemische und biologische Grundlagen
Cannabinoide sind eine heterogene Gruppe chemischer Verbindungen, die zunächst aus der Cannabispflanze (v. a. Cannabis sativa) isoliert wurden. Charakteristisch ist, dass sie an spezifische Cannabinoid-Rezeptoren im Körper binden und so unterschiedliche biologische Effekte auslösen. Chemisch zählen die meisten pflanzlichen Cannabinoide zu den Terpenphenolen – komplexe Moleküle, die Strukturelemente von Terpenen und Phenolen aufweisen. Im Gegensatz zu Alkaloiden enthalten natürliche Cannabinoide kein Stickstoffatom in ihrer Struktur. Ein bekanntes Beispiel ist Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), das wichtigste psychoaktive Cannabinoid der Hanfpflanze. THC wurde bereits 1964 von Gaoni und Mechoulam aus Cannabis isoliert [Gaoni & Mechoulam, 1964]. Seither wurden über 100 verschiedene Phytocannabinoide (pflanzliche Cannabinoide) in Cannabis identifiziert [Rock & Parker, 2021]. Neben THC gehören dazu z. B. Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN), Cannabigerol (CBG) und viele weitere, meist in geringeren Mengen vorkommende, Verbindungen.
Strukturformel von Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), einem typischen Phytocannabinoid der Cannabispflanze. THC ist ein terpenoid aufgebautes Molekül (ein bicyclisches aromatisches Terpenphenol) und verantwortlich für die psychotropen Effekte von Cannabis. Wie die meisten natürlichen Cannabinoide enthält THC kein Stickstoff und zählt daher nicht zu den Alkaloiden. Viele Cannabinoide liegen in der frischen Pflanze zunächst als Carboxylsäuren vor (z. B. THC-Säure) und werden erst durch Trocknung oder Erhitzung in ihre pharmakologisch aktiven neutralen Formen umgewandelt.
Der Begriff „Cannabinoid“ umfasst jedoch nicht nur Pflanzeninhaltsstoffe. Auch der menschliche Körper produziert eigene Cannabinoid-ähnliche Botenstoffe, die sogenannten Endocannabinoide. Darüber hinaus wurden zahlreiche synthetische Cannabinoide entwickelt. Trotz teils unterschiedlicher chemischer Strukturen vereint alle Cannabinoide ihre Fähigkeit, an die Cannabinoid-Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems anzudocken und ähnliche Signalwege auszulösen. Die Erforschung dieser Verbindungen führte letztlich zur Entdeckung des Endocannabinoid-Systems beim Menschen in den 1990er Jahren [Devane et al., 1992].
Arten von Cannabinoiden: phytogen, endogen und synthetisch
Cannabinoide lassen sich nach ihrer Herkunft in drei Hauptkategorien einteilen:
Phytocannabinoide (pflanzliche Cannabinoide)
Phytocannabinoide stammen aus Pflanzen, vor allem aus der Gattung Cannabis. Die Hanfpflanze produziert über hundert dieser Verbindungen in ihren Harzdrüsen (Trichomen) [Rock & Parker, 2021]. Die bekanntesten Phytocannabinoide sind Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). THC ist für die hauptsächlichen psychoaktiven Wirkungen von Cannabis verantwortlich – es erzeugt Rauschzustände („High“) und beeinflusst Wahrnehmung, Stimmung und Appetit. CBD hingegen wirkt nicht berauschend; ihm werden beruhigende, entzündungshemmende und anti-epileptische Eigenschaften zugeschrieben [Blessing et al., 2015]. Daneben existieren zahlreiche weitere, weniger verbreitete Phytocannabinoide: Cannabinol (CBN) entsteht z. B. als Abbauprodukt von THC und hat mild sedative Effekte, Cannabigerol (CBG) ist ein Vorläufermolekül vieler anderer Cannabinoide und zeigt in Studien entzündungshemmende Wirkungen, und Cannabichromen (CBC) könnte an schmerzmodulierenden Effekten beteiligt sein. Obwohl diese sekundären Cannabinoide in geringerer Konzentration vorkommen, rücken sie zunehmend in den Fokus der Forschung, da sie mögliche synergistische Effekte (Entourage-Effekt) in der Gesamtheit des Pflanzenextrakts entfalten könnten.
Phytocannabinoide wurden ursprünglich fast ausschließlich in Cannabis nachgewiesen, doch neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch einige andere Pflanzen Cannabinoid-ähnliche Substanzen bilden können. Beispielsweise enthalten Echinacea-Arten bestimmte Alkylamide, die an Cannabinoid-Rezeptoren (vor allem CB2) binden und cannabimimetische Effekte haben. Solche Fälle sind allerdings selten – die Cannabispflanze bleibt die weitaus bedeutendste Quelle für Phytocannabinoide.
Endocannabinoide (körpereigene Cannabinoide)
Endocannabinoide sind vom Körper selbst hergestellte Moleküle, die als Neurotransmitter im Endocannabinoid-System wirken. Die ersten Endocannabinoide wurden in den frühen 1990er Jahren entdeckt, kurz nachdem man die Rezeptoren für THC identifiziert hatte [Devane et al., 1992]. Strukturell leiten sich endogene Cannabinoide meist von Arachidonsäure (einer Fettsäure) ab. Zwei der wichtigsten Vertreter sind:
- Anandamid (AEA, chemisch N-Arachidonylethanolamid): Anandamid war das erste entdeckte Endocannabinoid. Es bindet an CB1-Rezeptoren ähnlich wie THC, wenn auch mit etwas geringerer Affinität. Der Name Anandamid leitet sich vom Sanskrit-Wort „Ananda“ (Glückseligkeit) ab, was auf seine stimmungsaufhellende Wirkung hinweist.
- 2-Arachidonoylglycerol (2-AG): Dieses Endocannabinoid ist chemisch ein Monoacylglycerol und bindet sowohl an CB1– als auch CB2-Rezeptoren. 2-AG kommt im Gehirn in relativ hoher Konzentration vor und spielt eine wichtige Rolle bei der retrograden neuronalen Signalübertragung (siehe unten).
Daneben sind noch weitere endogene Cannabinoid-Substanzen bekannt (z. B. 2-AG-Ether, N-Arachidonoyldopamin und andere). Interessanterweise wirken einige Endocannabinoide nicht nur an klassischen Cannabinoid-Rezeptoren, sondern können auch andere Rezeptorsysteme modulieren (z. B. TRPV1-Ionenkanäle oder bestimmte Serotonin-Rezeptoren). Endocannabinoide werden bei Bedarf vom Körper synthetisiert und nach ihrer Freisetzung rasch durch Enzyme abgebaut – Anandamid z. B. durch die Fettsäure-Amid-Hydrolase (FAAH) und 2-AG durch die Monoacylglycerol-Lipase (MAGL). So stellt der Körper sicher, dass die Cannabinoid-Signale zeitlich begrenzt bleiben.
Synthetische Cannabinoide
Synthetische Cannabinoide sind künstlich hergestellte Verbindungen, die in ihrer Wirkung die pflanzlichen oder endogenen Cannabinoide nachahmen. Erste Vertreter wurden in den späten 20. Jahrhundert zu Forschungszwecken entwickelt – beispielsweise das synthetische THC-Analogon HU-210 oder der Ligand CP-55,940. Viele dieser Substanzen binden sehr stark an Cannabinoid-Rezeptoren; HU-210 besitzt z. B. eine deutlich höhere Potenz als THC. In den 2000er-Jahren tauchten synthetische Cannabinoide auch als missbräuchliche Drogen auf (Stichwort „Spice“). Verbindungen wie JWH-018 oder AM-2201 wurden als vermeintlich „legale“ Cannabis-Ersatzstoffe verkauft, sind jedoch ungleich potenter und mit höheren Gesundheitsrisiken behaftet.
Synthetische Cannabinoide haben in der Medizin ebenfalls Bedeutung: So ist Dronabinol chemisch identisches THC, das als Medikament (z. B. zur Appetitstimulation) eingesetzt wird, und Nabilon ist ein synthetisches Cannabinoid-Derivat, das als Arzneimittel gegen Übelkeit zugelassen ist. Insgesamt umfasst die Gruppe der synthetischen Cannabinoide mittlerweile Hunderte von Verbindungen, die als Forschungswerkzeuge oder Therapeutika dienen – ihr gemeinsames Merkmal ist die Aktivierung des Endocannabinoid-Systems, teils jedoch mit ungewollten Nebenwirkungen aufgrund ihrer hohen Rezeptoraffinität.
Das Endocannabinoid-System (ECS) des Menschen
Das Endocannabinoid-System ist ein essentielles physiologisches System, das durch die Entdeckung von Cannabinoid-Rezeptoren und deren endogenen Liganden in den 1990er Jahren beschrieben wurde. Es setzt sich aus den Cannabinoid-Rezeptoren (hauptsächlich CB1 und CB2), den endogenen Cannabinoiden (Endocannabinoiden) als natürlichen Botenstoffen sowie den Enzymen zu deren Synthese und Abbau zusammen. Über dieses System üben Cannabinoide – ob aus der Pflanze, dem Körper selbst oder synthetisch – ihre Wirkung aus. Im Folgenden werden die beiden Rezeptortypen und die Signalübertragung im ECS genauer erläutert.
CB1– und CB2-Rezeptoren
CB1 und CB2 sind die beiden Hauptrezeptoren des Endocannabinoid-Systems. Dabei handelt es sich um Rezeptoren, die zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) gehören. Der CB1-Rezeptor wurde zuerst in den frühen 1990er-Jahren im Gehirn identifiziert und ist dort einer der am häufigsten vorkommenden GPCR überhaupt [Lu & Mackie, 2020]. CB1-Rezeptoren sind vor allem im Zentralnervensystem weit verbreitet – in Hirnregionen wie dem Hippocampus, den Basalganglien, dem Kleinhirn und der Großhirnrinde – was erklärt, warum Cannabinoide Gedächtnis, Motorik und Wahrnehmung beeinflussen können. Aber auch in peripheren Nerven, dem Darm und anderen Geweben finden sich CB1-Rezeptoren. Ihre Aktivierung führt überwiegend zu neuronalen Dämpfungseffekten (Verminderung der Freisetzung klassischer Neurotransmitter).
CB2-Rezeptoren hingegen wurden zunächst im Immunsystem entdeckt. Sie kommen vor allem auf Zellen der Immunabwehr vor – beispielsweise auf B- und T-Lymphozyten, Makrophagen und in Milz und Mandeln [Klein, 2005]. Auch im ZNS sind CB2-Rezeptoren in geringerem Maße vorhanden, insbesondere auf Mikrogliazellen (den Immunzellen des Gehirns). Die Rolle von CB2 ist vor allem immunmodulatorisch: Wird dieser Rezeptor aktiviert, kann dies die Freisetzung entzündungsfördernder Botenstoffe hemmen und entzündliche Prozesse abschwächen. Insgesamt kann man sagen, dass CB1 primär für die neuromodulatorischen Effekte (z. B. in Gehirn und Nervensystem) verantwortlich ist, während CB2 für die Steuerung von Immunreaktionen und Entzündungen wichtig ist.
Signalübertragung und Funktion des ECS
Vereinfachtes Schema der Signalübertragung im Endocannabinoid-System (synaptische Ebene). Endocannabinoide (grüne Punkte) werden bei neuronaler Aktivierung vom postsynaptischen Neuron freigesetzt und binden an präsynaptische CB1-Rezeptoren (orange). Dadurch wird die Freisetzung von Neurotransmittern aus den synaptischen Vesikeln (gelb) reduziert. Dieses retrograde Signal dient der kurzfristigen Rückkopplung und Hemmung der neuronalen Erregungsübertragung. In Immunzellen führt die Aktivierung von CB2-Rezeptoren zu einer Hemmung entzündlicher Signalkaskaden (nicht abgebildet).
Auf molekularer Ebene sind sowohl CB1 als auch CB2 an inhibitorische Gi/o-Proteine gekoppelt. Wird einer dieser Rezeptoren durch ein Cannabinoid (endogen oder extern zugeführt) aktiviert, resultiert daraus im Regelfall eine Hemmung der Adenylylcyclase im Zellinneren. Dadurch sinkt die Konzentration des sekundären Botenstoffs cAMP. In Neuronen führt CB1-Aktivierung zudem dazu, dass spannungsabhängige Calciumkanäle an der präsynaptischen Endigung blockiert und Kaliumkanäle geöffnet werden. Die Folge ist eine verminderte Freisetzung von erregenden Neurotransmittern wie Glutamat oder hemmenden Neurotransmittern wie GABA aus der präsynaptischen Zelle. Dieses Prinzip der retrograden neuronalen Signalübertragung bedeutet, dass das postsynaptische Neuron bei starker Aktivierung eine Art „Feedback-Signal“ an die vorgeschaltete Zelle sendet, um die weitere Ausschüttung von Transmittern zu bremsen. Dadurch trägt das Endocannabinoid-System zur Homöostase im Gehirn bei, indem es extreme Erregungszustände dämpft [Lu & Mackie, 2020].
Neben der direkten Beeinflussung von Ionenkanälen und cAMP-Signalen können Cannabinoid-Rezeptoren auch andere Signalwege modulieren. So wurde gezeigt, dass die Aktivierung von CB1 und CB2 bestimmte Mitogen-aktivierte Proteinkinasen (MAP-Kinasen) anstößt, was langfristige Effekte auf Genexpression und Zellfunktion haben kann. Die komplexe Signalkaskade des ECS ist Gegenstand intensiver Forschung. Festzuhalten ist, dass dieses System an einer Vielzahl physiologischer Prozesse beteiligt ist – darunter Schmerzmodulation, Appetitregulation, Gedächtnisprozesse, Stressreaktionen und Immunfunktionen [Lu & Mackie, 2020; Klein, 2005].
Medizinische Wirkungen und Einsatzgebiete von Cannabinoiden
Die vielfältigen Effekte von Cannabinoiden auf Körper und Psyche machen sie für unterschiedliche medizinische Anwendungsgebiete interessant. In den letzten Jahrzehnten haben sich einige Indikationen herauskristallisiert, bei denen Cannabinoid-basierte Medikamente geprüft oder bereits eingesetzt werden. Wichtig ist, dass sich die Wirksamkeit oft auf bestimmte Cannabinoide konzentriert – insbesondere auf Δ9-THC und CBD – und dass die Studienlage je nach Indikation unterschiedlich robust ist. Im Folgenden werden einige zentrale Einsatzbereiche beleuchtet und die wissenschaftliche Evidenz sowie wirksame Substanzen erläutert.
Schmerzlinderung (analgetische Wirkung)
Cannabinoide werden vor allem bei chronischen Schmerzen untersucht, insbesondere bei neuropathischen Schmerzen, die auf herkömmliche Schmerzmittel oft unzureichend ansprechen. THC wirkt schmerzlindernd, indem es sowohl im zentralen Nervensystem die Schmerzwahrnehmung dämpft als auch peripher Entzündungen modulieren kann. In klinischen Studien und Übersichtsarbeiten zeigte sich, dass Cannabinoid-Therapien bei chronischen Schmerzpatienten im Durchschnitt zu einer spürbaren Linderung führen können [Whiting et al., 2015].
In einer Meta-Analyse berichtete eine höhere Anzahl von Patienten unter cannabinoidhaltiger Behandlung eine Reduktion ihrer Schmerzen um ≥30% verglichen mit Placebo [Whiting et al., 2015]. Besonders für neuropathische Schmerzen (etwa bei Nervenschädigungen oder Diabetes) gibt es Hinweise auf Wirksamkeit.
Typischerweise kommen THC-dominante Präparate zum Einsatz, wie z. B. Dronabinol (synthetisches THC) oder kombinierte THC/CBD-Extrakte (Nabiximols). Dabei wird oft ein Ausgleich zwischen analgetischer Wirkung und psychoaktiven Nebenwirkungen angestrebt, z. B. durch Kombination mit CBD. Insgesamt wird die Evidenz für den Einsatz von Cannabinoiden bei chronischen Schmerzen heute als substanziell eingestuft [Whiting et al., 2015].
Epilepsie
Ein Durchbruch in der medizinischen Anwendung von Cannabinoiden ist die Behandlung bestimmter schwerer Epilepsieformen mit Cannabidiol (CBD). CBD besitzt keine berauschende Wirkung, zeigt jedoch in Studien signifikante antiepileptische Effekte. Insbesondere bei seltenen, therapieresistenten Epilepsie-Syndromen im Kindesalter (wie dem Dravet-Syndrom oder Lennox-Gastaut-Syndrom) konnte CBD die Anfallshäufigkeit deutlich reduzieren [Devinsky et al., 2017]. In einer randomisierten placebokontrollierten Studie mit Dravet-Patienten sank die mediane Anzahl konvulsiver Anfälle unter CBD um ca. 39%, verglichen mit 13% unter Placebo [Devinsky et al., 2017]. Diese Ergebnisse führten zur Zulassung eines hochgereinigten CBD-Präparats (Handelsname Epidiolex) zur Behandlung dieser Epilepsien. Obwohl die genauen Wirkmechanismen von CBD bei Epilepsie noch erforscht werden (CBD bindet kaum an CB1/CB2 und wirkt vermutlich über andere Signalwege), gilt es heute als wirksame Zusatztherapie für bestimmte kindliche Epilepsieformen. THC spielt in der Epilepsie-Behandlung dagegen keine Rolle, da es eher das Risiko für Krampfanfälle erhöhen kann.
Angststörungen und PTSD
Die Wirkung von Cannabinoiden auf Angst und Psyche ist komplex: Niedrige Dosen von THC können anxiolytisch (angstlösend) wirken, höhere Dosen hingegen Angst und Paranoia verstärken. CBD zeigt in diesem Kontext ein interessanteres Profil, da es in Studien eher angstlösende Eigenschaften ohne berauschende Effekte zeigt. Präklinische Untersuchungen und erste klinische Versuche deuten darauf hin, dass CBD Symptome von Angststörungen lindern kann [Blessing et al., 2015]. So beobachtete man etwa in einer kleinen Studie, dass CBD die Prüfungsangst bei sozialer Angststörung senkte, gemessen an physiologischen Stressmarkern und Selbstauskunft der Probanden.
Die vermuteten Mechanismen umfassen eine Beeinflussung des serotonergen Systems (CBD bindet als Agonist an 5-HT1A-Rezeptoren) sowie eine Abschwächung der Stress-Hormon-Ausschüttung. Auch bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) wird die Gabe von CBD diskutiert, da es das Wiedererleben traumatischer Erinnerungen reduzieren könnte. Allerdings ist die Datenlage von Cannabis bei Angststörungen insgesamt noch begrenzt und Studien haben oft kleine Fallzahlen. Weitere Forschung ist nötig, um Dosierung, Sicherheit und Langzeiteffekte von CBD bei Angstpatienten zu evaluieren. THC als Monotherapie ist wegen seiner psychotropen Unberechenbarkeit weniger geeignet, könnte aber in sehr geringer Dosierung in Kombination mit CBD in Einzelfällen helfen. Insgesamt gilt CBD als der vielversprechendste Cannabinoid-Wirkstoff im Kontext von Angststörungen [Blessing et al., 2015].
Appetitsteigerung und Gewichtsverlust (z. B. bei HIV/AIDS, Krebs)
Eines der bekanntesten Einsatzgebiete von THC ist die Appetitstimulation. Patienten mit starkem ungewolltem Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit – etwa bei AIDS-bedingter Auszehrung (Wasting-Syndrom) oder während einer Krebsbehandlung – konnten von THC-Präparaten profitieren. In klinischen Studien mit HIV/AIDS-Patienten führte Dronabinol (orales THC) zu einer Zunahme des Appetits und Stabilisierung des Körpergewichts [Beal et al., 1995]. In der genannten Studie berichteten 38% der THC-behandelten Patienten von Appetitverbesserung gegenüber nur 8% unter Placebo; zudem nahmen signifikant mehr THC-Patienten an Gewicht zu [Beal et al., 1995]. Aufgrund solcher Befunde wurde Dronabinol bereits in den 1990er Jahren zur Therapie der AIDS-assoziierten Kachexie zugelassen.
Auch Krebspatienten, die infolge von Chemotherapie unter Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit leiden, können von Cannabinoiden profitieren. THC-haltige Medikamente wie Nabilon (ein THC-Derivat) zeigen antiemetische Wirkungen und steigern den Appetit, weshalb sie in einigen Ländern als Begleitmedikation bei Chemotherapie zugelassen sind. Meta-Analysen bestätigen, dass Cannabinoide wirksamer als Placebo in der Kontrolle von Chemotherapie-Übelkeit sind [Whiting et al., 2015]. Für diese Anwendungsgebiete gilt THC als der wichtigste Wirkstoff – CBD alleine zeigt hier wenig Effekt –, wobei die Dosis sorgfältig angepasst werden muss, um psychische Nebenwirkungen gering zu halten.
Muskelspastik bei Multiple Sklerose (MS)
Ein etabliertes Anwendungsgebiet von Cannabinoiden in Europa ist die Behandlung von Spastik bei Multipler Sklerose. Patienten mit MS leiden häufig unter schmerzhaften Muskelverkrampfungen, die auf herkömmliche Spasmolytika nur begrenzt ansprechen. Studien haben gezeigt, dass eine Kombination aus THC und CBD (in Form eines oromukosalen Sprays, Handelsname Sativex/Nabiximols) die Spastiksymptomatik verbessern kann [Kleiner et al., 2023]. In einer systematischen Übersichtsarbeit wurden randomisierte Studien ausgewertet und insgesamt eine signifikante Reduktion der Spastikstärke unter Nabiximols festgestellt, insbesondere bei Patienten, die auf Standardtherapien nicht ausreichend ansprachen [Kleiner et al., 2023]. Viele Betroffene berichten unter der Cannabinoid-Therapie von verminderten Muskelkrämpfen und besserem Schlaf. Nabiximols ist in zahlreichen Ländern (darunter Deutschland) für die Zusatzbehandlung der mittelschweren bis schweren MS-Spastik zugelassen, wenn andere Medikamente nicht genügend wirken.
Die wirksamen Komponenten dabei sind THC und CBD in einem definierten Verhältnis 1:1 – THC trägt zur Muskelentspannung und Schmerzlinderung bei, während CBD möglicherweise spasmolytische Effekte verstärkt und gleichzeitig die THC-bedingten psychotropen Nebenwirkungen abmildern könnte. Die Therapie sollte nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, da Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel oder mentale Beeinträchtigungen auftreten können.
Entzündungshemmung und Immunmodulation
Durch die dichte Verteilung von CB2-Rezeptoren auf Immunzellen wurde früh deutlich, dass Cannabinoide auch das Immunsystem beeinflussen. Insbesondere in präklinischen Studien zeigte sich, dass Aktivierung des Endocannabinoid-Systems entzündliche Reaktionen dämpfen kann [Klein, 2005]. So führt die Bindung von Cannabinoiden an CB2 dazu, dass weniger entzündungsfördernde Zytokine ausgeschüttet und bestimmte Immunzellen in ihrer Aktivität gebremst werden [Klein, 2005]. In Tiermodellen für Arthritis, Multiple Sklerose oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen konnte durch Cannabinoid-Gaben eine Abschwächung der Entzündung erzielt werden.
Allerdings ist die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den Menschen noch Gegenstand der Forschung. Erste klinische Pilotstudien – etwa mit Cannabis bei Morbus Crohn – ergaben teils positive Effekte auf Symptome, aber nicht immer auf die zugrundeliegende Entzündung. Nichtsdestotrotz wird an cannabinoiden Wirkstoffen mit gezielt entzündungshemmender Wirkung geforscht. CBD etwa, das kein Psychotropikum ist, hat in Zellkultur und Tierversuchen deutliche anti-inflammatorische Eigenschaften gezeigt und könnte perspektivisch bei Autoimmunerkrankungen zum Einsatz kommen. Auch synthetische selektive CB2-Agonisten werden entwickelt, um Entzündungen zu behandeln, ohne zentralnervöse Nebenwirkungen zu verursachen. Insgesamt deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass Cannabinoide ein interessantes therapeutisches Potenzial bei Entzündungen besitzen, auch wenn klinische Beweise hier noch limitiert sind [Klein, 2005].
Aktuelle Studienlage und Forschungsperspektiven
Die Forschung zu Cannabinoiden und dem Endocannabinoid-System hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Immer mehr hochwertige Studien untersuchen sowohl die klinischen Anwendungen als auch die zugrundeliegenden Wirkmechanismen dieser Substanzen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass für einige Indikationen (Schmerz, Spastik, Epilepsie, Übelkeit) bereits eine relativ solide Evidenz vorliegt, während andere potenzielle Anwendungen (etwa bei Angststörungen oder entzündlichen Erkrankungen) noch einer intensiven Erforschung bedürfen. Große systematische Übersichtsarbeiten – wie z. B. eine Meta-Analyse in JAMA – haben die Wirksamkeit von medizinischem Cannabis bei chronischen Schmerzen, Muskelspastik und Übelkeit/Erbrechen bestätigt, mahnen jedoch auch an, dass viele Studien kleine Fallzahlen haben und methodische Schwächen aufweisen [Whiting et al., 2015].
Gegenwärtig richten sich viele Forschungsanstrengungen darauf, die spezifischen Wirkungsmechanismen einzelner Cannabinoide besser zu verstehen. So wird erforscht, warum CBD beispielsweise antiepileptisch wirkt, ohne direkt die bekannten Cannabinoid-Rezeptoren zu aktivieren – hier kommen alternative Target-Strukturen wie Kalziumkanäle oder GPR55-Rezeptoren in Betracht. Auch das Zusammenspiel verschiedener Cannabinoide (Stichwort „Entourage-Effekt“) wird untersucht, um möglicherweise synergistische Effekte in Vollspektrum-Extrakten zu nutzen. Darüber hinaus werden neue synthetische Cannabinoid-Verbindungen entwickelt, die selektiver wirken sollen – etwa reine CB2-Agonisten zur Entzündungshemmung ohne ZNS-Effekte, oder allosterische Modulatoren der Cannabinoid-Rezeptoren, die die körpereigenen Signale verstärken, statt den Rezeptor direkt zu aktivieren.
Ein weiteres spannendes Feld ist die Onkologie: In Zellkultur und Tierversuchen zeigten einige Cannabinoide wie THC und CBD direkte tumorhemmende Effekte (z. B. Wachstumshemmung von Gliomzellen). Klinische Studien dazu stehen jedoch erst am Anfang, und es gibt noch keine belastbaren Belege, dass Cannabinoide das Tumorwachstum beim Menschen kontrollieren können. Dennoch laufen erste klinische Prüfungen, beispielsweise zur Unterstützung der Krebstherapie durch Kombinationsgabe von Cannabinoiden mit Chemotherapeutika.
Zudem nimmt die Erforschung des Endocannabinoid-Systems bei verschiedenen Krankheiten zu. Hinweise deuten darauf hin, dass Dysfunktionen im ECS an der Pathophysiologie etwa von Migräne, Fibromyalgie oder Reizdarmsyndrom beteiligt sein könnten – eine Hypothese, die als „klinisches Endocannabinoid-Mangel-Syndrom“ bezeichnet wird. Sollte sich das bestätigen, könnten Cannabinoid-Therapien in Zukunft auch bei solchen chronischen Leiden eine Rolle spielen.
Abschließend lässt sich sagen, dass Cannabinoide zu den interessantesten pharmakologischen Substanzen der Gegenwart zählen. Ihre medizinische Nutzbarkeit wird zunehmend durch wissenschaftliche Studien untermauert, auch wenn noch viele Fragen offen sind – etwa zu optimalen Dosierungen, langfristiger Sicherheit, Wechselwirkungen und genauen Wirkmechanismen. Mit der fortschreitenden Legalisierung von medizinischem Cannabis in vielen Ländern erweitert sich auch die Datenbasis durch Registerstudien und klinische Forschung. Zukünftige Studien werden zeigen, in welchen weiteren Bereichen Cannabinoide therapeutisch sinnvoll eingesetzt werden können. Schon jetzt zeichnen sich aber klare Anwendungsgebiete ab, in denen der Nutzen die Risiken überwiegt – vorausgesetzt, die Behandlung erfolgt unter ärztlicher Kontrolle und mit qualitativ gesicherten Präparaten.
Quellen
- Gaoni, Y., & Mechoulam, R. (1964): Isolation, structure and partial synthesis of an active constituent of hashish. Journal of the American Chemical Society, 86(8), 1646–1647.
- Devane, W. A., Hanuš, L., Breuer, A., et al. (1992): Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science, 258(5090), 1946–1949.
- Lu, H.-C., & Mackie, K. (2020): Review of the endocannabinoid system. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 6(6), 607–615.
- Rock, E. M., & Parker, L. A. (2021): Constituents of Cannabis sativa. Advances in Experimental Medicine and Biology, 1264, 1–13.
- Whiting, P. F., Wolff, R. F., Deshpande, S., et al. (2015): Cannabinoids for medical use: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 313(24), 2456–2473.
- Devinsky, O., Cross, J. H., Laux, L., et al. (2017): Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. New England Journal of Medicine, 376(21), 2011–2020.
- Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015): Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders. Neurotherapeutics, 12(4), 825–836.
- Beal, J. E., Olson, R., Laubenstein, L., et al. (1995): Dronabinol as a treatment for anorexia associated with weight loss in patients with AIDS. Journal of Pain and Symptom Management, 10(2), 89–97.
- Kleiner, D., Horváth, I. L., Bunduc, S., et al. (2023): Nabiximols is efficient as add-on treatment for patients with multiple sclerosis spasticity refractory to standard treatment: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. Current Neuropharmacology, 21(12), 2505–2515.
- Klein, T. W. (2005): Cannabinoid-based drugs as anti-inflammatory therapeutics. Nature Reviews Immunology, 5(5), 400–411.